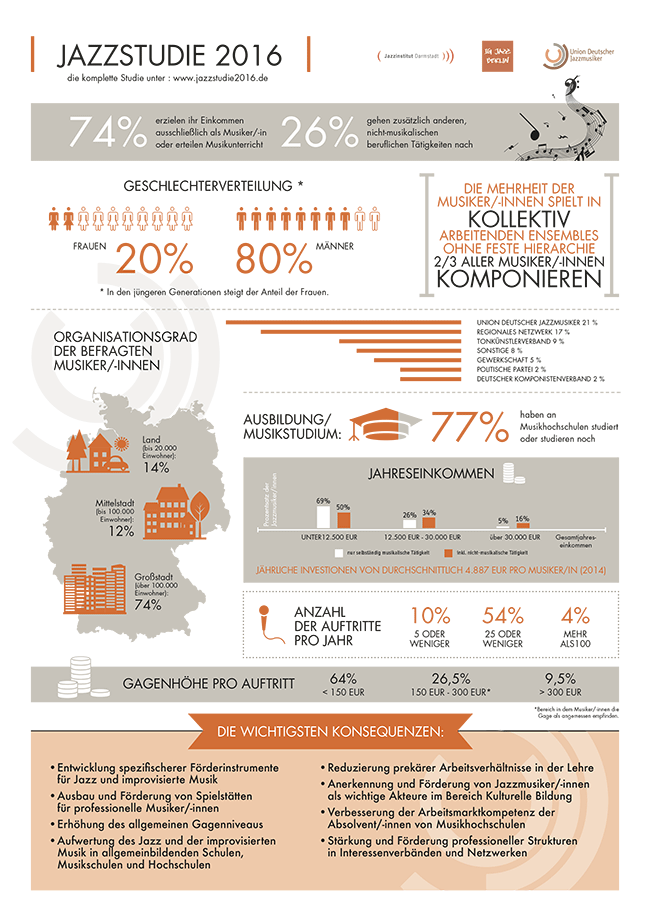Selbstbewusst präsentieren die Macher der „Jazzstudie 2016“ (Union Deutscher Jazzmusiker, Jazzinstitut Darmstadt, IG Jazz Berlin, Autor: Thomas Renz, Universität Hildesheim) ihre Arbeit: „Zum allersten Mal führte im vorliegenden Fall eine universitäre Einrichtung eine empirische Untersuchung unter Jazzmusikerinnen und Jazzmusikern in Deutschland durch, deren 2.135 verwertbare Datensätze ausreichend Rohmaterial für wichtige inhaltliche Analysen liefern, um daraus wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen für die politischen und administrativen Körperschaften abzuleiten.“
Tatsächlich bietet die Studie auf Basis einer Online-Befragung von 1.860 befragten Menschen, die den Fragebogen komplett ausfüllten und die sich als professionelle Jazzmusiker einschätzen, eine Fülle interessanter Daten. Soziodemografische Informationen (80% Musiker / 20% Musikerinnen), Daten zur Bildung (93% Abitur oder FH-Reife), Informationen zur wirtschaftlichen Lage (erschreckend), Verteilung von Instrumenten (viele Schlagzeuger…) und auch biographische Informationen bezüglich des Zugangs zum Jazz und zum beruflichen Werdegang.
Wenn Siegmund Ehrmann, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag behauptet: „Mit der Jazzstudie 2016 liegen endlich belastbare Zahlen vor, auf die Kulturpolitik jetzt reagieren muss.“, dann darf man zwar auf die Reaktion der Kulturpolitik gespannt sein (die vermutlich auf ihre bisherigen Errungenschaften wie den Spielstättenpreis verweisen wird) aber sollte die Belastbarkeit der Zahlen besser nicht allzu sehr betonen.
Aus meiner Sicht krankt die Studie am Fundament und den Autoren ist die Problematik wohl auch bewusst, wenn sie formulieren: „Die Frage nach der Repräsentativität dieser Teilnahmezahlen lässt sich nur bedingt beantworten, da die Grundgesamtheit der Jazzmusiker/-innen schlicht unbekannt ist. Die Zahlen der Künstlersozialkasse können einen Orientierungswert darstellen: Dort sind gegenwärtig 4.663 selbstständige Jazzmusiker/-innen versichert. Werden diese in Bezug zu den Teilnehmer/-innen der Onlinebefragung gesetzt, welche eben auch eine KSK-Mitgliedschaft angegeben haben, so wird deutlich, dass etwa 40% der dort versicherten Jazzmusiker/-innen in dieser Studie abgebildet werden.“ Daraus ziehen sie den Schluss, dass die Quote von 40% zumindest in Bezug auf die Mitglieder der KSK „sehr zufriedenstellend“ sei.
So ganz trauen sie ihrem befragten Klientel trotzdem nicht, wenn sie beschreiben, wie „wichtig eine Qualitätskontrolle“ und „Qualitätssicherung“ der erhobenen Daten war und die ein leichtes Misstrauen gegenüber der Repräsentativität der Befragung kommt auch in „Bei einem solchen offenen Vorgehen lässt sich eine leicht überdurchschnittliche Teilnahme bestimmter Gruppen nicht vermeiden. Insbesondere besser vernetzte, ggf. auch onlineaffine Musiker/-innen sind in dieser Studie leicht überrepräsentiert. Vermutlich betrifft das vor allem jüngere Musiker/-innen, welche in dieser Studie sehr gut vertreten sind, sowie Musiker/-innen, die an einer (Musik-) Hochschule studiert haben.“
Da könnte man auch noch ein drittes Mal „leicht“ schreiben, auf das „ggf.“ verzichten und es wäre „vermutlich“ trotzdem genau anders herum: in dieser Befragung sind vor allem die genannten Gruppen nicht „leicht“ sondern deutlich überrepräsentiert. Und die These, dass die Musiker, die tatsächlich aktiv – und vielleicht sogar etwas besser gebucht – als Jazzmusiker zugange sind, weder Zeit noch Lust haben sich mit dem Ausfüllen von Fragebögen zu befassen, die liegt auch nicht allzu weit entfernt. Schaut man auf die soziodemografischen Merkmale der Befragung, dann liegt dort der Anteil der bis 40-jährigen bei 56,5%, was tendenziell eher für eine schwerpunktmäßige Teilnahme der „Generation Internet“ steht und auch der Generation „Jazz-Hochschule“, die das Bild der Studie prägt. Interessanterweise bilden neun anonyme – wie schade – Interviews, aus denen im Verlauf der Studie gelegentlich zitiert wird, einen Altersschnitt von rund 43 Jahren ab.
Vor allem im Kontext mit – für mich wirklich erstaunlichen – Zahlen zum Thema „Live-Auftritte als Jazzmusiker“ wird die Datenbasis der Studie unter dem Aspekt „Professionelle Jazzmusiker“ fragwürdig. Auf Seite 35 ist zu lesen, dass 10% der Befragten 1-5 Auftritte pro Jahr (!) bestreiten, weitere 15% 6-10 Auftritte. Das heißt von den befragten „Professionellen Jazzmusikern“ haben über ein Drittel statistisch gesehen weniger als einen Auftritt pro Monat und über die Hälfte (54%) kommen auf maximal 25 Auftritte im Jahr (also etwa ein Auftritt alle zwei Wochen)!
Die Verfasser der Studie sehen darin ein „erstes Indiz dafür, dass „Jazzmusik machen“ …nur einen Teil der beruflichen von professionellen Jazzmusiker/-innen ausmacht“. Das kann man so sehen aber man könnte auch hinterfragen: mit was für einer Art von „Jazzmusik“ haben wir es dann eigentlich zu tun? Könnte es sein, dass wir es hier in großer Zahl eher mit Musikschullehrern und anderweitig Beschäftigten zu tun haben, die nebenher etwas Jazz spielen? Eine Musik – und das mag jetzt eine unverschämt subjektive Wahrnehmung sein – deren Essenz im Live-Spielen liegt? Leise Zweifel daran, dass die Basis der Studie wirklich den „professionellen Jazz“ in Deutschland repräsentiert (oder repräsentierten sollte?) seien erlaubt.
Wenn in der Zusammenfassung „Politische und manageriale (?) Konsequenzen“ gefordert werden, so pendeln die zwischen fragwürdig: „Nachwuchs fördern“ an erster Stelle (um einen ohnehin engen Markt mit weiteren Jazz-Hochschülern zu beglücken), sinnvoll: „Arbeitsmarktkompetenz verbessern“, political correctness: „Musikhochschulen können überprüfen und diskutieren, inwieweit geschlechtsspezifische Aspekte in ihren Strukturen implizit oder explizit ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis fördern oder verhindern“ und schwer durchzusetzenden Allgemeinforderungen wie „Gagenniveau erhöhen“: „Deutlich wird, dass die Verbesserung der finanziellen Situation für Jazzmusiker/-innen die höchste Priorität auf der kulturpolitischen Agenda der Betroffenen hat. 575 Nennungen machen darauf aufmerksam, dass es aus ihrer Sicht einer musikpolitischen Künstler/-innen- und/oder Spielstättenförderung bedarf. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass Jazzmusik in Deutschland nicht allein privatwirtschaftlichen Märkte überlassen werden kann, sondern dass diese Kunstmusik eben einer staatlichen Einflussnahme im Sinne der Förderpolitik bedarf.“
Frei nach Brecht könnte man formulieren: „Erst kommt das Fressen, dann die kulturpolitische Agenda“, sprich: mit Kultur hat es zunächst herzlich wenig zu tun, ob die Kasse stimmt; und ob es dem Jazz wirklich gut tut, wenn er nur als „Kunstmusik“ am Tropf staatlicher Förderpolitik überlebensfähig bleibt, darüber kann man trefflich streiten.
(fs)